
„Luther Weg“ – wer das hört, denkt an Bahnübergang, Oststadt oder ehemaliges Iglo- und späteres Vion-Werk. Doch der Straßenname ist in Wunstorf mittlerweile auch zu einem Synonym für Flüchtlingsunterbringung geworden. Im ehemaligen Verwaltungsgebäude des Werks, das das Industriegelände zur Straßenseite hin begrenzt, befindet sich derzeit Wunstorfs größtes kommunales Wohnheim für Geflüchtete.
Es ist ein Haus, das es eigentlich gar nicht geben sollte, denn Wunstorf ist bemüht, Flüchtlinge in normalen Mietwohnungen unterzubringen, und tut dies größtenteils auch. Knapp 750 Flüchtlinge leben derzeit in Wunstorf, der überwiegende Teil in von der Stadt gemieteten Wohnungen. Seit der Flüchtlingswelle 2015 war das jedoch nicht mehr möglich, das Gebäude wurde hergerichtet. Ursprünglich sollten sogar vier Flüchtlingswohnheime errichtet werden, neben dem Luther Weg entstand jedoch dann nur noch das Containerdorf in Großenheidorn, das als „Reserve“ lange nicht belegt wurde, in dem inzwischen aber auch Flüchtlinge untergebracht sind. Betrieben werden die Heime von den Johannitern.
Platz für 125 Bewohner
Betritt man das Wohnheim durch den Vordereingang, dann glaubt man sich zunächst im falschen Gebäude. Das Foyer könnte auch das Entré einer Start-up-Firma sein, und der Wachdienst, der hier rund um die Uhr vor Ort ist, wirkt wie eine Hotelrezeption. Man bekommt fast den Eindruck eines gealterten Hotels aus den 60er Jahren. Außen mit Patina, innen mit Charme. An den Wänden stehen schwarze Ledersofas. Der Fahrstuhl ist noch im Originalzustand. Die Wand daneben dient als Schwarzes Brett. Hier hängen die Informationen meist in drei bis vier Sprachen aus: Deutsch, Englisch, Arabisch und Farsi.
Auf der Rückseite liegt der eigentliche Eingang zu den Flüchtlingsunterkünften. Denn dass die Bewohner nicht den Eingang auf der Straßenseite benutzen, ist eine Auflage, die bei der Einrichtung des Heimes mit Politik und Anwohnern ausgehandelt wurde. Auf der Rückseite stehen auch die Fahrräder der Bewohner. So finden auch die Raucherpausen auf der Gebäuderückseite statt, hier spielt sich im abgegrenzten Hof ein Teil des eigentlichen Lebens ab. Auf einer großen Wiese stehen Kletterstangen und Schaukeln.
Die Leiterin der Einrichtung, Lena Finch, empfängt uns in ihrem Büro, das im Gemeinschaftstrakt liegt, und räumt gleich mit einem Irrtum auf: Die meisten der hier wohnenden Flüchtlinge kommen gar nicht aus Syrien oder dem Irak, sondern aus Afghanistan. Viele sind sogenannte „Alleinreisende“, dazu kommen einige Familien mit Kindern. Die Nationalitäten und Religionen gehen wild durcheinander. 125 Plätze gibt es, 120 sind derzeit belegt. Längeren Leerstand gibt es eigentlich nie. 21 Nationen wohnen aktuell im Luther Weg, ein Drittel sind Kinder.
Erstmal Mülltrennung lernen
Es ist erstaunlich ruhig im Gebäude – in manchen Mehrfamilienhäusern geht es geräuschvoller zu. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Bewohner gerade gar nicht im Haus, sondern unterwegs sind. Sie besuchen Sprach- oder Integrationskurse, die für fast alle verpflichtend sind. Basiskurse geben Starthilfe für den Alltag in Deutschland, denn was für Deutsche das Normalste auf der Welt ist, kann für die Welt durchaus erklärungsbedürftig sein. Das fängt bei der Mülltrennung an, geht über die Notwendigkeit, Arzttermine pünktlich einzuhalten, bis zum Fahren mit Bus und Bahn. Manche Kurse finden direkt im Wohnheim statt, doch die Heimbewohner fahren dazu auch in die umliegenden Städte, nach Garbsen, Hannover oder Neustadt. Nur Mütter mit Kleinkindern sind z. B. davon befreit. Die Jüngsten im Flüchtlingsheim sind es dann auch, die sich bemerkbar machen. Winkend stehen sie bisweilen an den Scheiben des Treppenhauses und an den Fenstern und gucken neugierig, wer da gerade zu Besuch gekommen ist.















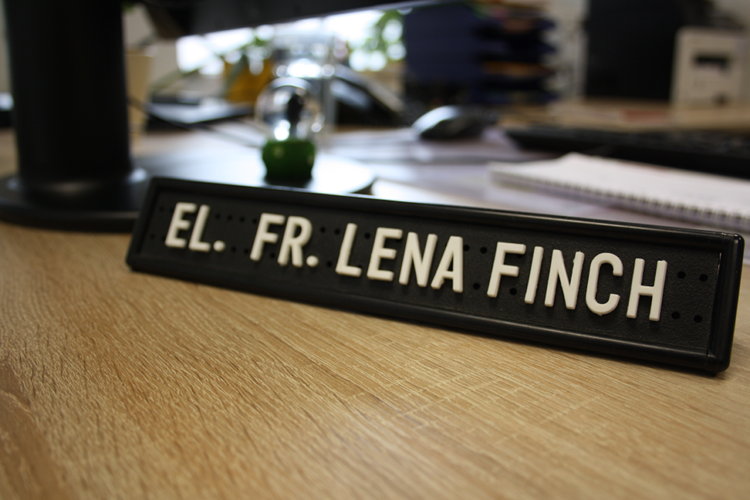


[/tie_slide]



Über vier Etagen erstreckt sich das Wohnheim. Im Erdgeschoss findet man auch ein Spielzimmer für die Kinderbetreuung oder die Kleiderkammer mit gespendeten Anziehsachen. Frauenkleidung gibt es im Überfluss, Männer haben keine große Auswahl – dabei bewohnen mehr Männer als Frauen das Heim. In den oberen Trakten leben die Bewohner, getrennt nach Familien- und Alleinreisendenetagen. Vor dem „Männertrakt“ stehen Fitnessgeräte, vorm Familientrakt Kinderwagen. Die große Hausküche im Erdgeschoss dient nur besonderen Anlässen, gekocht wird normalerweise in den Gemeinschaftsküchen auf den Etagen. Pro Trakt gibt es auch Gemeinschaftstoiletten, -duschen und einen Wäscheraum, in dem Waschmaschinen in Zweierreihen übereinanderstehen.
Triste Zimmer
Die Zimmer selbst sind minimalistisch ausgestattet: Tisch und Stühle, Metallbetten, Metallspinde. Aus Sicherheitsgründen muss die Einrichtung feuerfest sein, erklärt Finch. Den Bewohnern wird aber viel Freiheit bei der eigenen Einrichtung zugestanden – was auch genutzt wird. Wer aus dem Fenster schaut, sieht entweder auf das brachliegende Gelände der alten Tiefkühlprodukteproduktion mit der Hochstraße im Hintergrund oder die schmucken Häuser der Oststadt. Einige Ankömmlinge seien schockiert, wenn sie sich im Wohnheim wiederfinden, da sie mit falschen Vorstellungen nach Deutschland kämen, berichtet Finch. Sie glaubten, bei ihrer Ankunft würden sie alle sofort ein eigenes Haus bekommen. Stattdessen erhalten neue Bewohner im Wohnheim nur die Erstausstattung: Bettwäsche, Handtücher, Kochgeschirr und Reinigungsutensilien. Als Flüchtling lebt man am Existenzminimum und hat einen ähnlichen finanziellen Spielraum wie ein ALG-II-Empfänger.
„Das Wichtigste ist, dass man guten Kontakt hat.“
Lena Finch
Auf dem Flur treffen wir auf eine der Bewohnerinnen, die gerade einen Wäschekorb vor die Tür stellt. Finch begrüßt sie wie eine gute Freundin, die man zufällig beim Einkaufen trifft. Die Kinder im Spielzimmer brechen in Begleitung zum Spielplatz auf. Ehrenamtliche kommen sporadisch zum Helfen ins Wohnheim, meist Jüngere oder Ältere, aber es sind immer dieselben. Die Hauptarbeit wird in zwei Schichten geleistet, sodass mindestens drei Mitarbeiter vor Ort sind. Ihre Mitarbeiter wirken ebenso herzlich wie Finch selbst.
Zwei Jahre oder länger
Um ein gutes Klima im Haus muss man sich nicht bemühen, es herrscht offenbar bereits. Wie eine große WG – das träfe es nicht ganz, da die Menschen, die hier lebten, viel zu unterschiedlich seien, sagt Finch. Manche Bewohner sähe sie quasi nur beim Einzug und dann kaum noch, andere stünden täglich in ihrer Tür und suchten das Gespräch. Doch werde vonseiten der Johanniter alles versucht, um ein Gemeinschaftsgefühl zu etablieren. Es soll nicht nur ein Heim, sondern auch ein Zuhause sein, selbst wenn es nur ein vorübergehendes ist. Denn das Flüchtlingsheim ist vor allem auch Zwischenstation. Sehr viele Flüchtlinge, die später in Wunstorf eine eigene Wohnung bekommen, haben zumindest zeitweise zunächst auch im Luther Weg gewohnt. Familien wohnen durchschnittlich ein halbes Jahr im Luther Weg, bevor sie in eine Wohnung umziehen können. Alleinstehende bleiben länger, viele zwei Jahre oder mehr. Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht.
„Oh ja.“
Lena Finch auf die Frage, ob es männliche Bewohner gibt, die Probleme mit einer weiblichen Heimleitung haben.
Probleme gibt es manchmal, wenn männliche Bewohner mit kulturell traditionellen Rollenvorstellungen auf die Heimleiterin Finch treffen. Doch das legt sich schnell. Letztlich ist sie die bestimmende Instanz, und ihre männlichen Kollegen nehmen sich dann die Betreffenden auch mal zur Seite für ein klärendes Gespräch. Große Konflikte kämen im Wohnheim nicht vor. Ernste Schwierigkeiten habe es während ihrer Zeit nie gegeben, sagt Finch. Wenn die Polizei tatsächlich einmal vor der Tür steht, dann nicht, weil sie jemand gerufen hat. Meist geht es dann um die Klärung und Fragen zum Aufenthaltsstatus bei einzelnen Bewohnern.
Trotz allem Engagement vor Ort – gemeinsames Backen mit dem ganzen Haus, Ausflüge, Veranstaltungen – bleibt es eine Übergangslösung. Die Tage des Wohnheims sind gezählt, auf dem Areal soll langfristig ein neues Viertel entstehen. Wie lange es das Wohnheim noch an diesem Standort gibt und was danach kommt, ist ungewiss.
INFO: Flüchtlinge in Wunstorf 745 Flüchtlinge aus 21 Nationen leben aktuell in Wunstorf. 166 Wohnungen hat die Stadt zur Flüchtlingsunterbringung angemietet. 59 derzeit noch freie Plätze in Wohnungen und Heimen werden demnächst wieder belegt.
Diese Reportage war Teil der Titelgeschichte in Auepost 11/2019.



































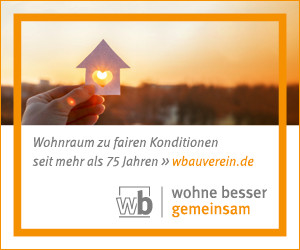





Schreibe einen Kommentar